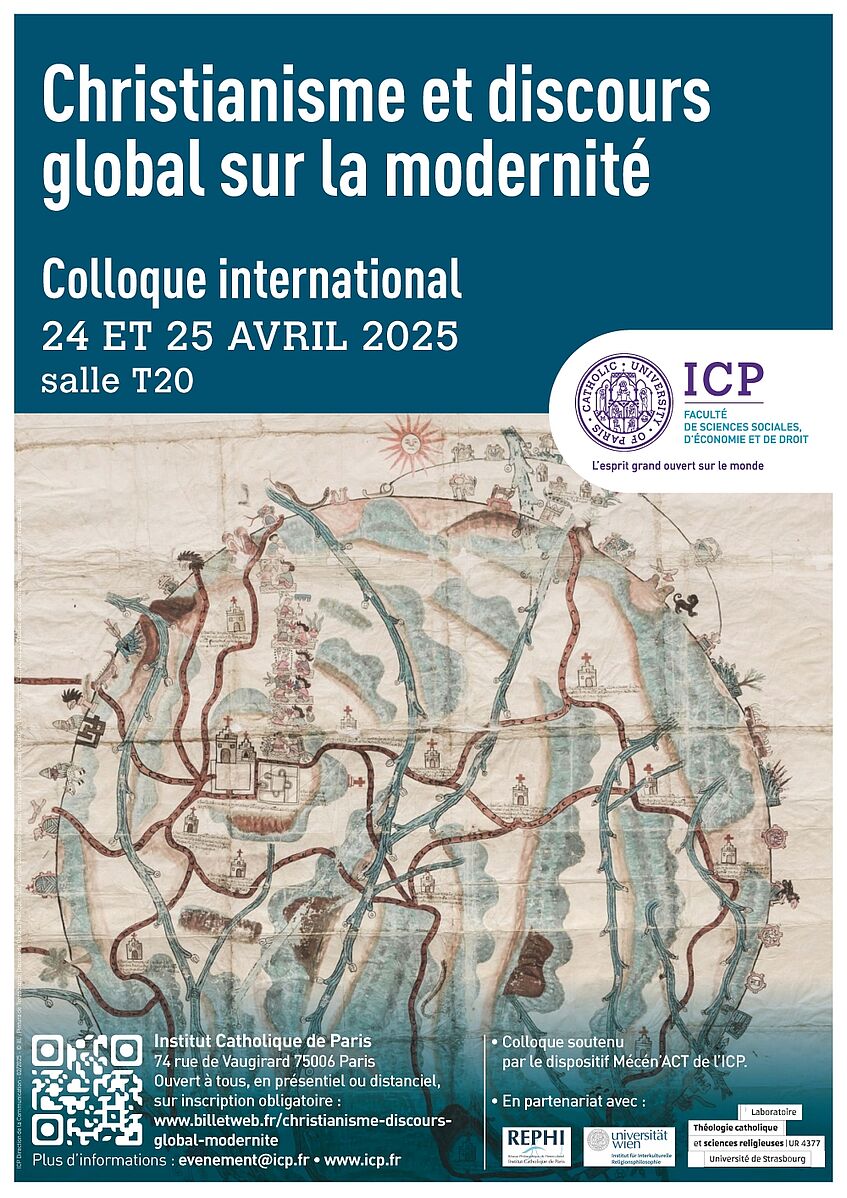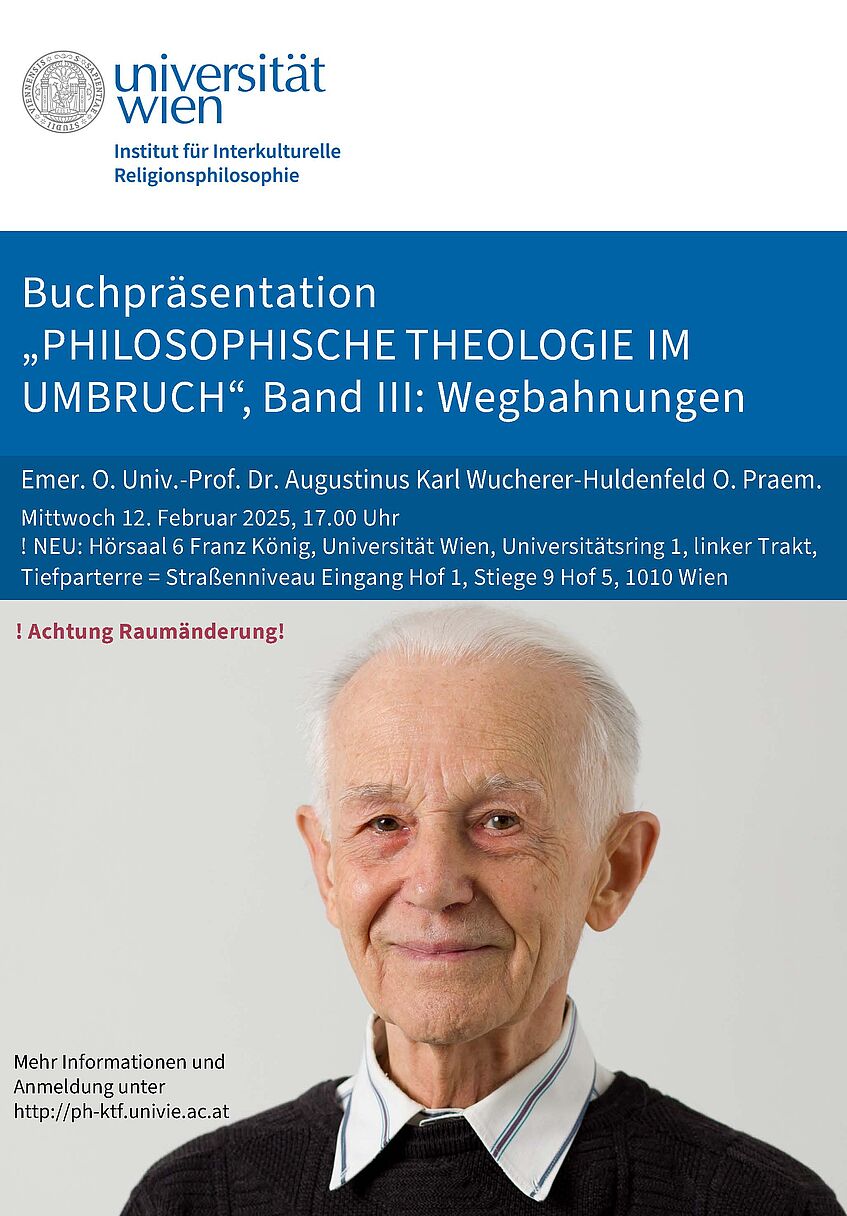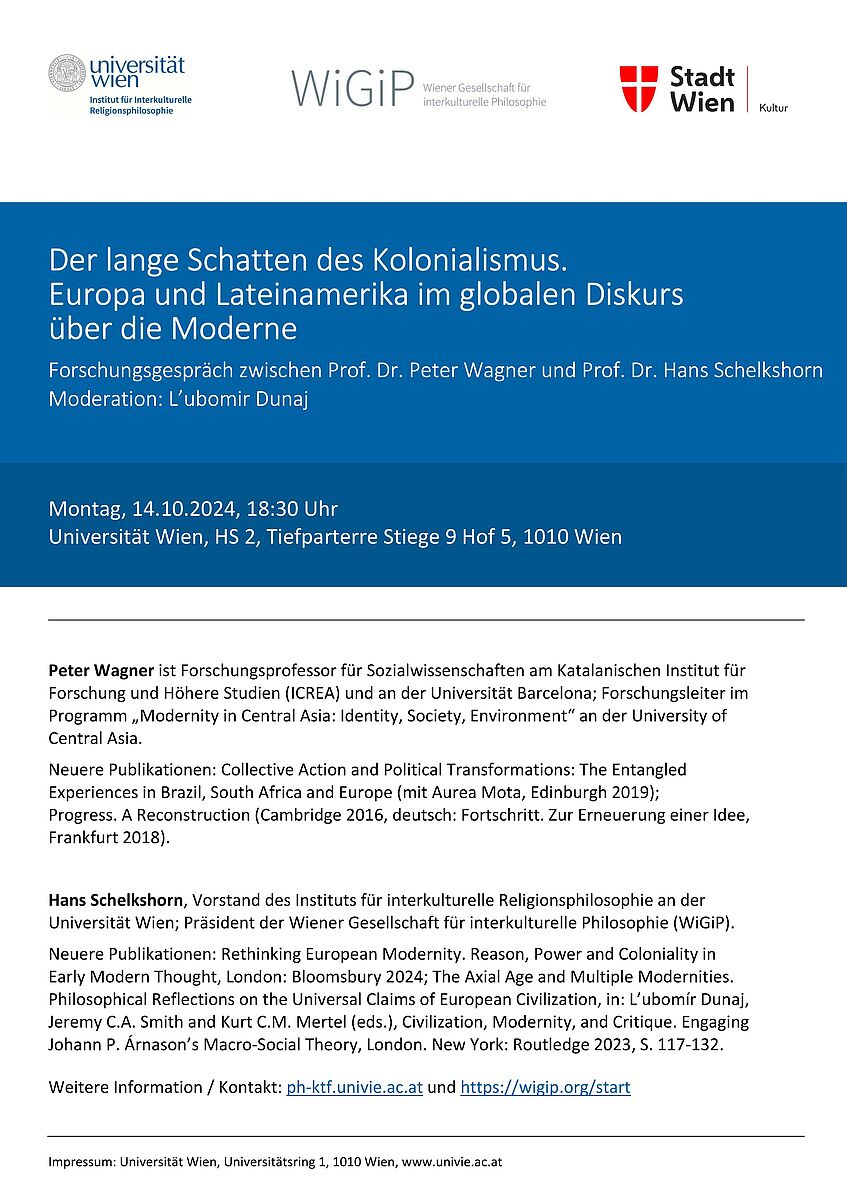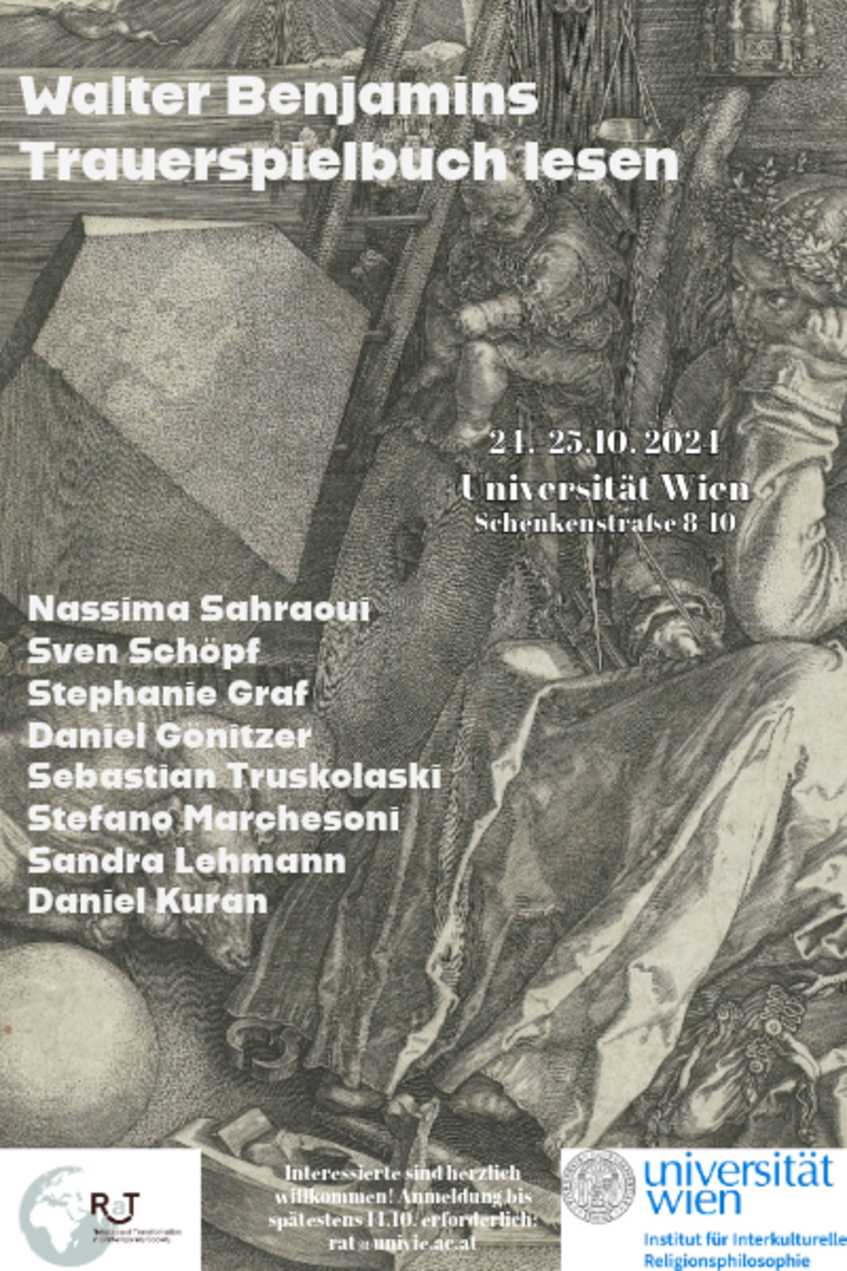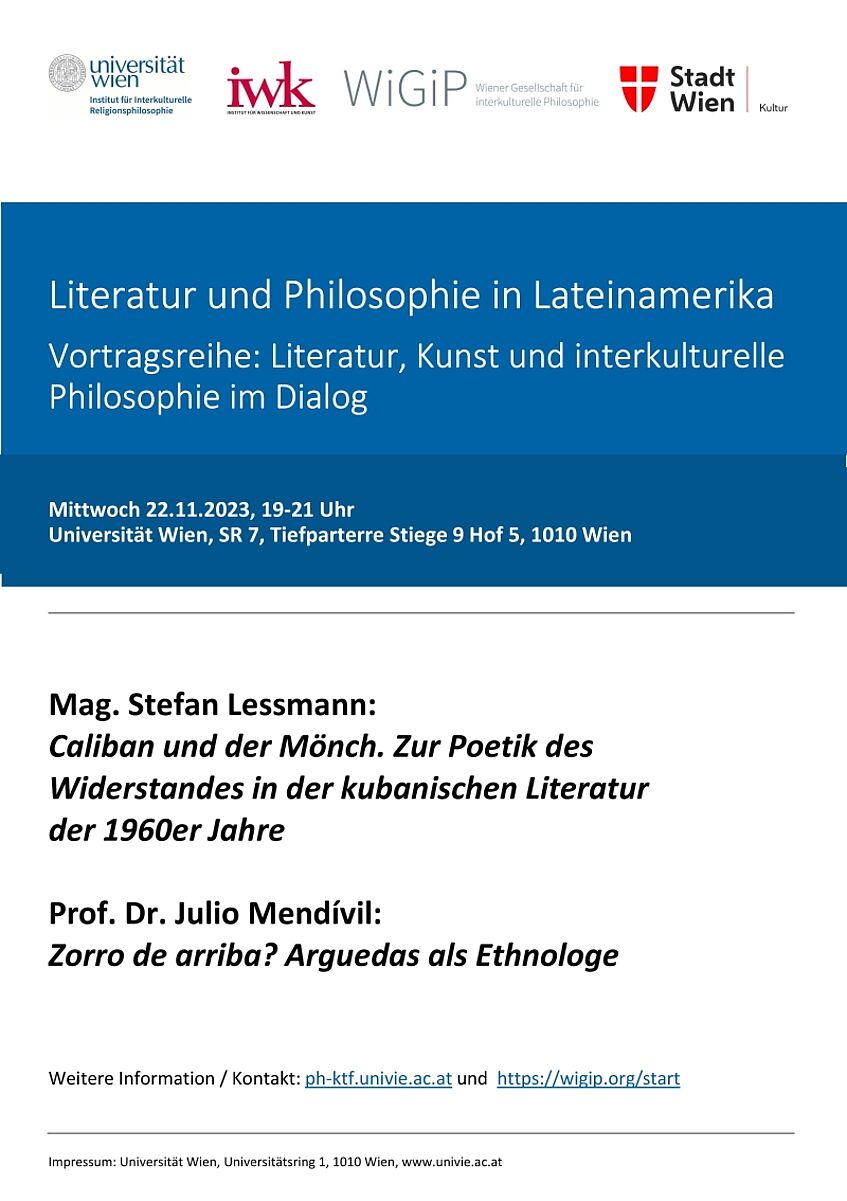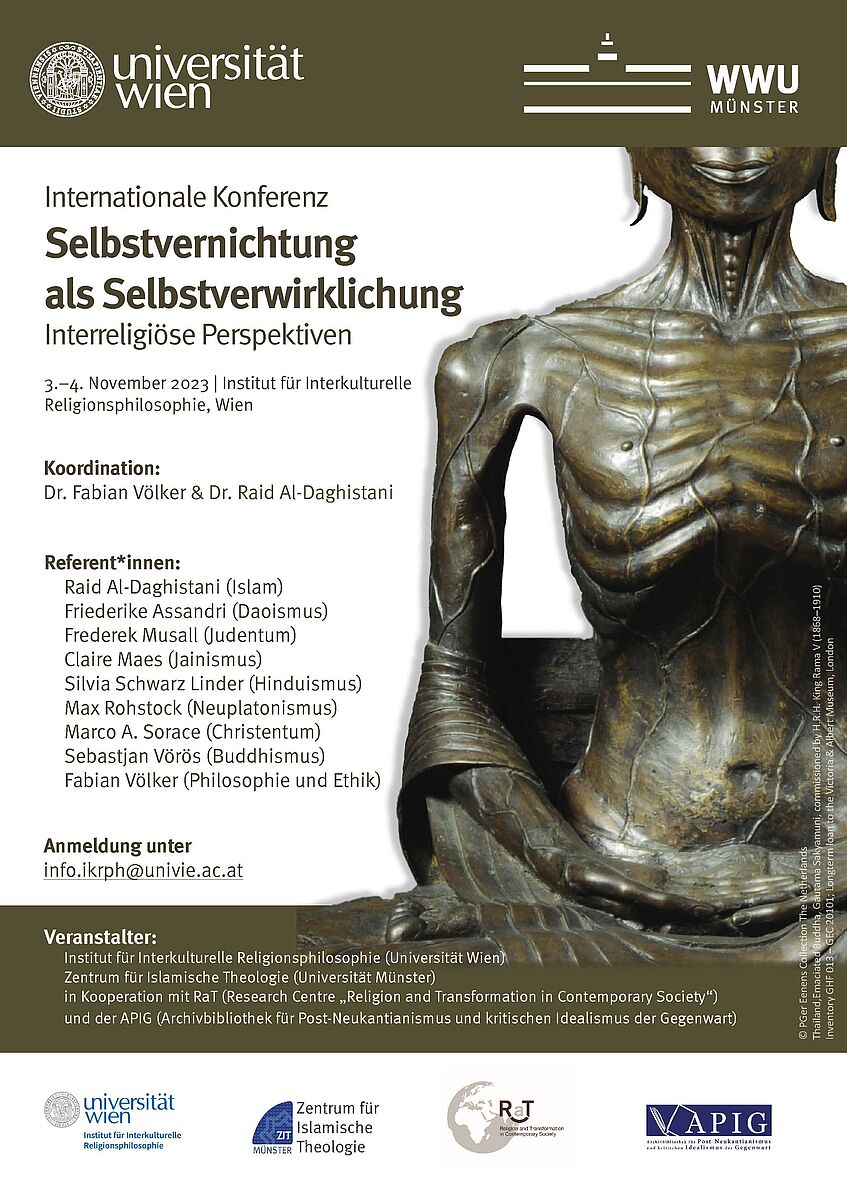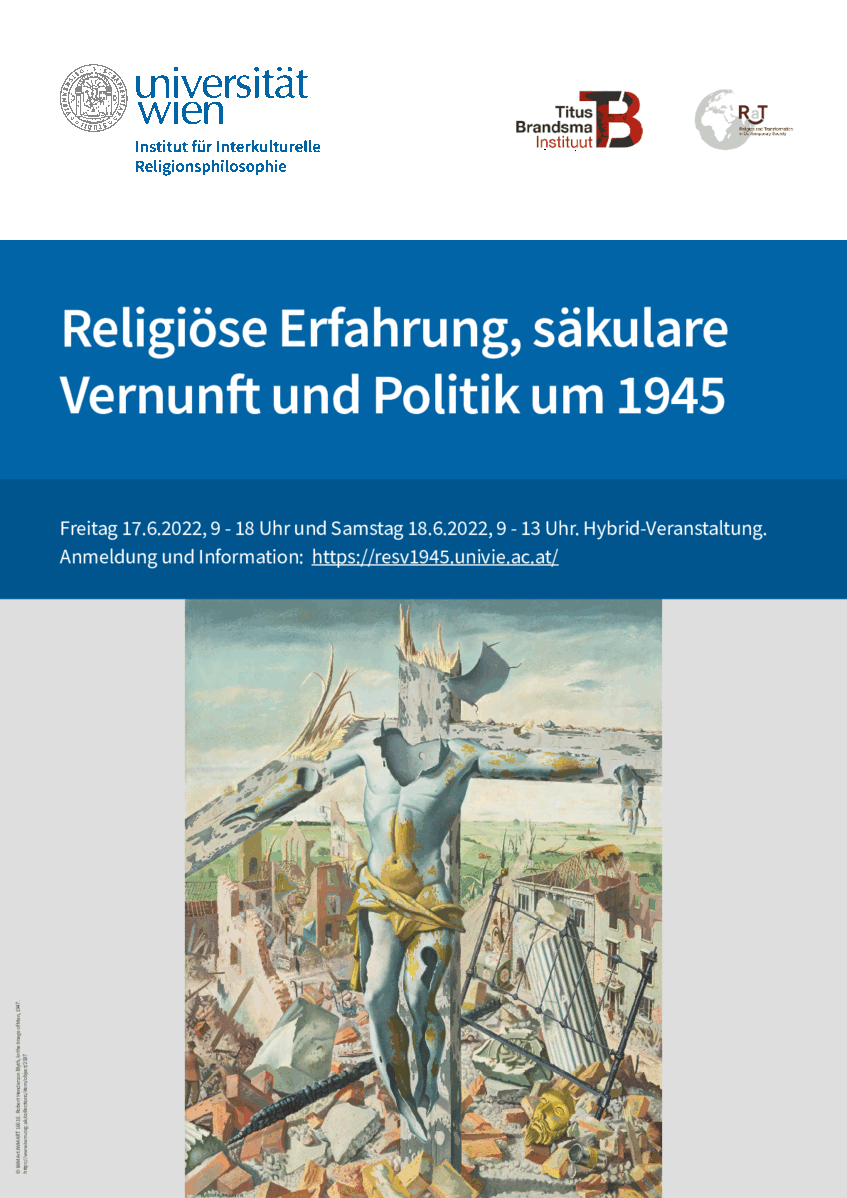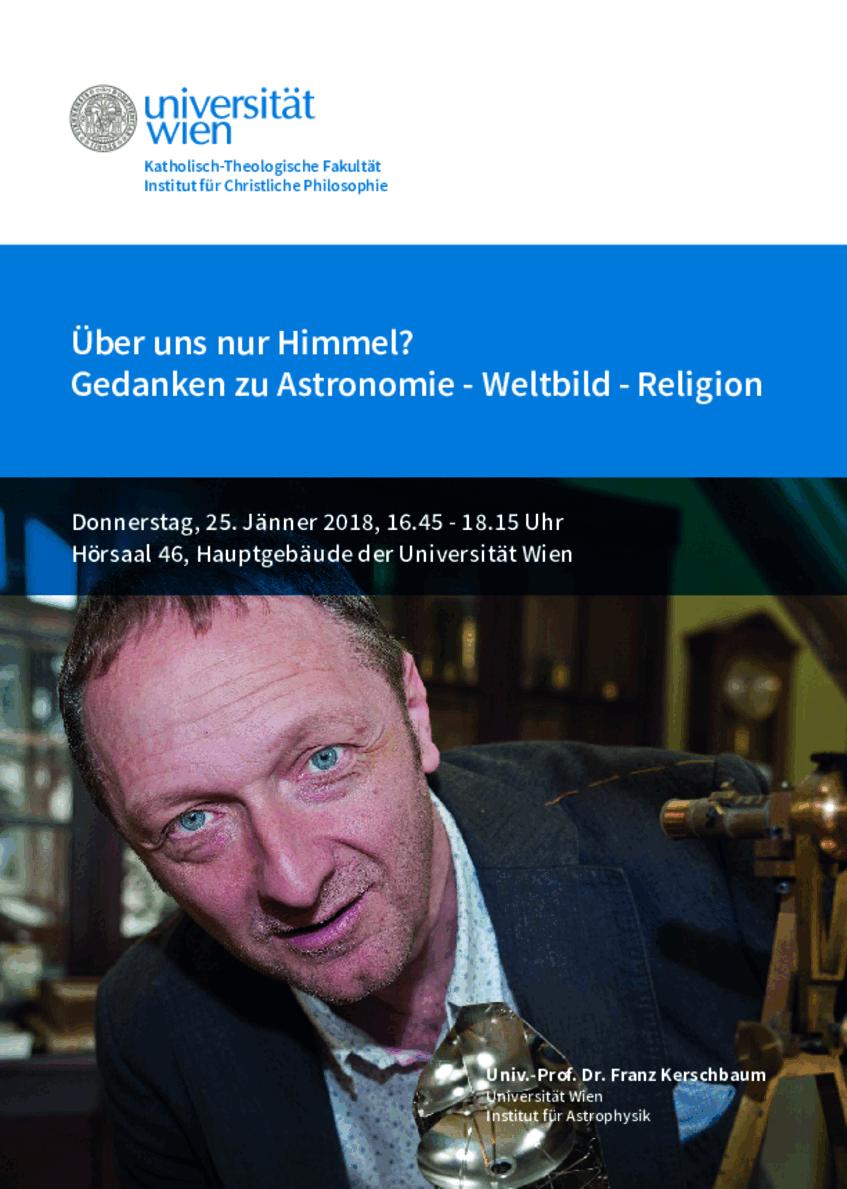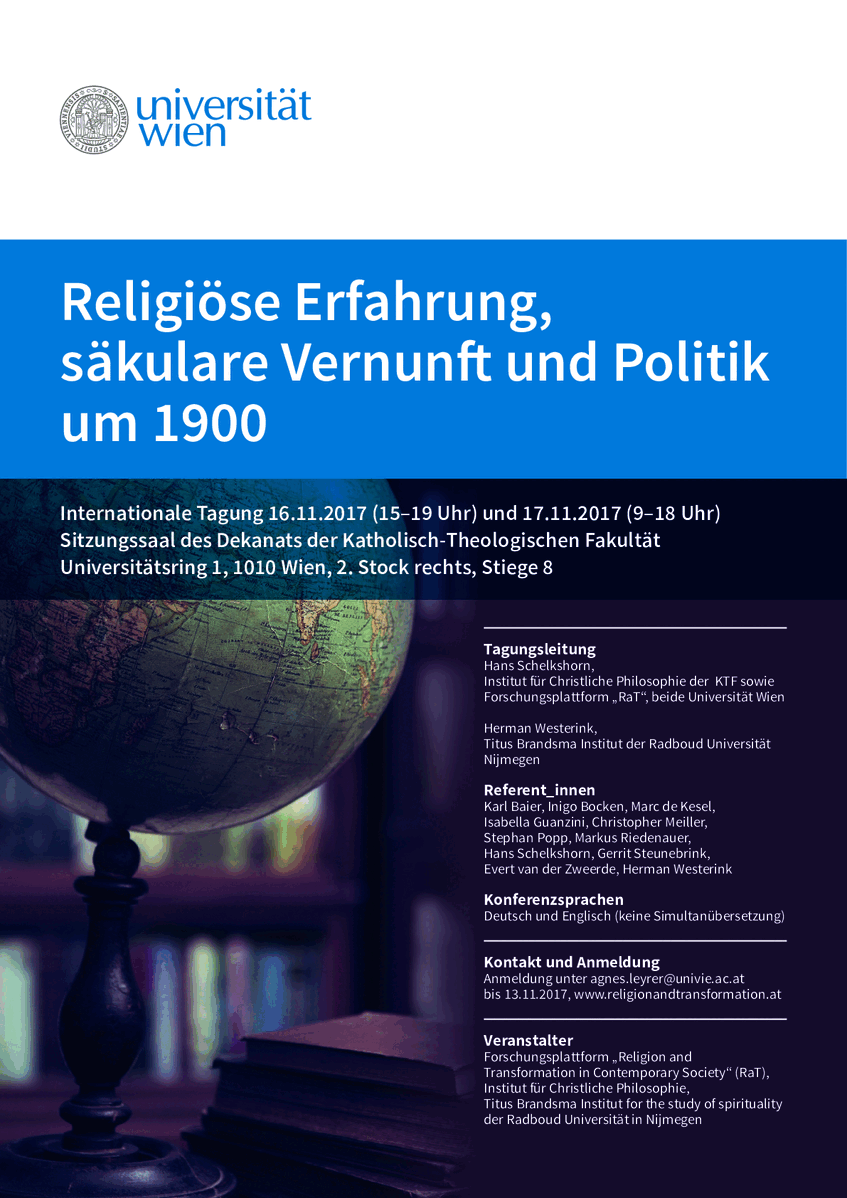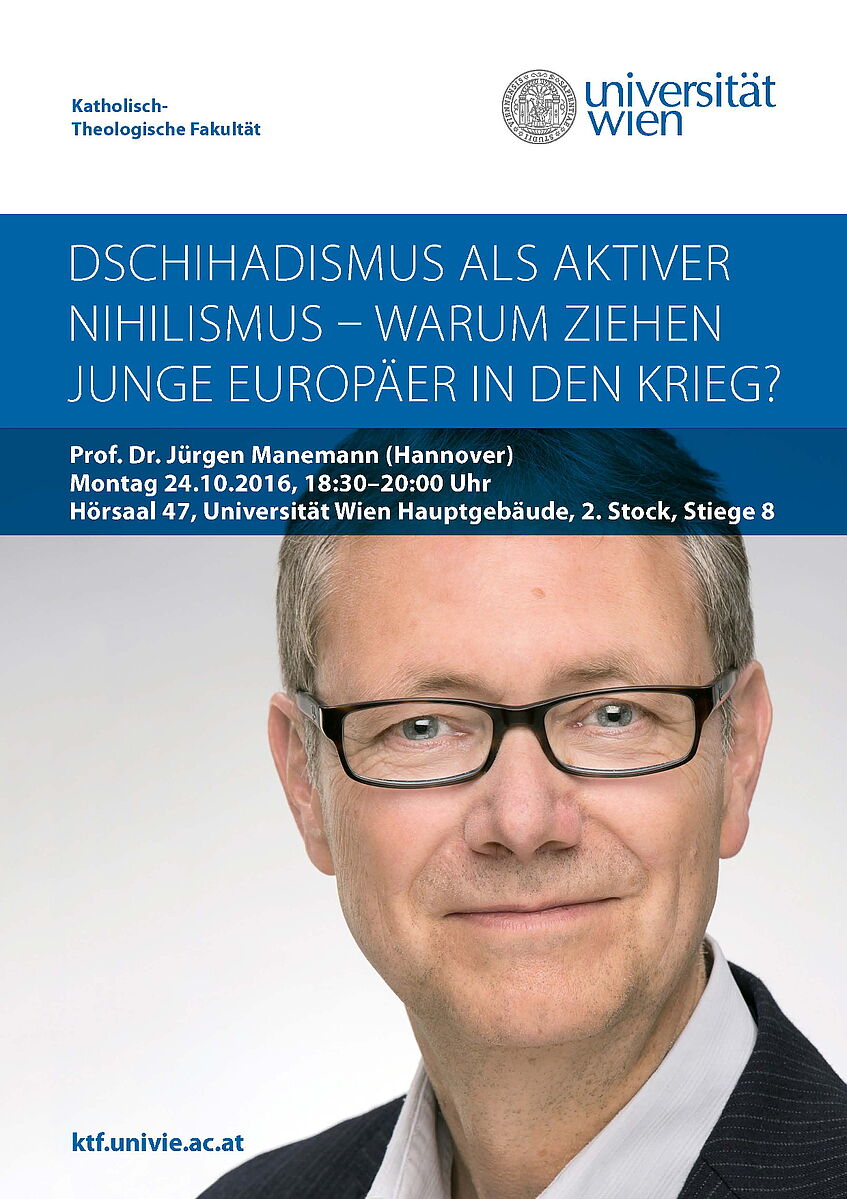Alle großen religiösen Traditionen kennen das Phänomen der Selbstvernichtung als Aufhebung des Individualbewusstseins in die unterschiedlich ausgedeutete Absolutheit. Dabei reicht das Spektrum von traditionsspezifischen Varianten transzendentaler Selbstvernichtung, bei denen sich das individuelle Begriffsdenken im Andenken an das unbestimmbare Absolute im Sinne einer docta ignorantia denkend selbst vernichtet, über psycho-spirituelle Techniken mentaler Selbstvernichtung, die auf die restlose Unterdrückung aller kognitiven, affektiven und voluntativen Vermögen des Menschen zielen, bis zu konkreten religionshistorischen Beispielen faktischer Selbstvernichtung, in denen dem ekstatischen Erfassen des Absoluten der physische Tod korrespondiert.
Da sich jede ernstzunehmende Diskussion religionsphilosophischer und theologischer Fragen unter den Bedingungen einer unhintergehbaren Globalisierung nur noch auf der systematischen Grundlage einer kultur- und religionsübergreifenden Reflexion sinnvoll und zeitgemäß vollziehen kann, findet die Tagung als multilaterales Kolloquium statt. Beiträge aus allen großen religiösen Traditionen liefern dabei die religionshistorische Grundlage, um das traditionsüberschreitende Phänomen der Selbstvernichtung in seinen metaphysischen, erkenntnistheoretischen, existenziellen und ethischen Implikationen im Sinn einer interkulturellen Religionsphilosophie und interreligiösen Theologie umfassend zur Anzeige zu bringen.
Koordination: Dr. Fabian Völker & Dr. Raid Al-Daghistani
Veranstalter: Institut für Interkulturelle Religionsphilosophie (Universität Wien) und Zentrum für Islamische Theologie (Universität Münster) in Kooperation mit RaT (Research Centre “Religion and Transformation in Contemporary Society”) und der APIG (Archivbibliothek für Post-Neukantianismus und kritischen Idealismus der Gegenwart)
Konferenzsprachen: Deutsch und Englisch (keine Simultanübersetzung)
Tagungsort: Sitzungssaal des Dekanats der Katholisch-Theologischen Fakultät,
Universität Wien Hauptgebäude, Universitätsring 1, 2. Stock rechts, Stiege 8, 1010 Wien.
Streaming: Die Vorträge werden auch online übertragen via ZOOM:
Meeting ID: 694 9261 9669
Kenncode: 681281
Einladungslink:
univienna.zoom.us/j/69492619669
Anmeldung: info.ikrph@univie.ac.at - fast alle Plätze vergeben
ACHTUNG, U-Bahn U4 fährt bis 5.11. nicht zwischen Schwedenplatz und Karlsplatz.